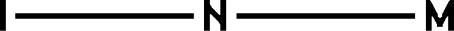Synthese von Philosophie und Neurobiologie?
Überlegungen anläßlich einiger Thesen von G.ROTH (und H.SCHWEGLER)
AUTHOR: Dr. Gerd Döben-Henisch
FIRST DATE: December 20, 1995
DATE of LAST CHANGE: December 20, 1995
Bewußtsein als Konstruktion
Neurobiologische Untersuchungen legen die These nahe, daß sämtliche bewußten Zustände Konstruktionen des Gehirns sind (GW94 insgesamt, bes. S.225f, oder KRSG92 S.107f).
Realität und Wirklichkeit
Der Kontext der Untersuchung ist damit das konstruierte Bewußtsein. Das konstruierte Bewußtsein ist nicht die Realität 'an sich', sondern Wirklichkeit, d.h. Selbsterfahrung des Gehirns, die bestimmten Bedingungen unterliegt (KRSG92 S.115, Bes. GW94, S.288f, S.293f).
Subjektive Voraussetzungen der empirischen Neurobiologie
Die Neurobiologie versteht sich als empirische Wissenschaft. Empirische Wissenschaft definiert sich über 'empirische' Daten und logisch konsistente Aussagengefüge (Theorien), die die Daten maximal konsistent 'erklären'. 'Empirisch' sind Daten, wenn sie mindestens intersubjektiv sind und sich reproduzieren lassen. Spezielle Meßapparate auf der Basis schon vorhandener empirischer Theorien können das Erzeugen von Daten 'stabiliseren' (z.B. GW94, S.294, S.313).
Eine empirische Wissenschaft kann aber nicht losgelöst von ihren biologischen Voraussetzungen betrachtet werden! Auch eine empirische Wissenschaft unterliegt den speziellen Bedingungen des Gehirns, das Wahrnehmung, Kommunizieren, Denken etc. ermöglicht. So sind sämtliche empirische Theorien trotz allem auch 'subjektive' Theorien, wenngleich die Beschränkung auf 'intersubjektive' Daten die Kommunizierbarkeit und 'Stabilität' empirischer Aussagen im Vergleich zu Theorien, die auch 'rein subjektive' Daten zulassen, erhöht (GW94, S.313).
Geist als physikalischer Zustand
Roth und Schwegler meinen nun, daß man die Eigenschaft des 'Geistes' als 'physikalischen Zustand' rekonstruieren kann ohne auf die Spezifität von Geist verzichten zu müssen (GW94 S.273f, EuS S.76).
Sie führen dies auf die Tatsache zurück, daß man alle jene Zustände, denen wir 'Geist' bzw. 'Bewußtsein' zusprechen, mittels heutiger Meßmethoden mit spezifischen Aktivitätsmustern im Gehirn parallelisieren (korrelieren) kann. Eine solche Korrelation zeige zudem, daß diejenigen Aktivitätsmuster, die mit Geist korreliert werden, notwendig von jenen geistigen Zuständen begleitet werden (GW94 S.275, EuS S.76). Sie stellen ferner die These auf, daß es keine geistigen Zustände geben kann, ohne daß diesen nicht irgendwelche neurologischen Aktivitätsmuster spezifisch korrelieren (strenge Parallelität) (GW94 S.255).
Aufgrund dieser Sachlage fühlen sie sich berechtigt, den Term 'Geist' als physikalischen (im Sinne von empirischen) Begriff einzuführen, der genau jene spezifischen Aktivitätsmuster umfaßt.
Keine Reduktion
Der so eingeführte Begriff Geist läßt sich nicht auf die einzelnen Systemkomponenten (Nervenzellen) reduzieren, da ihm spezifische -und dazu sich dynamisch verändernde- Erregungsmuster in zahlreichen Nervenzellverbänden gleichzeitig zukommen. Eine Rekonstruktion dieser Sachverhalte mittels einer der bekannten physikalisch-naturwissenschaftlichen Beschreibungssprachen konnte bisher nicht vorgelegt werden und erscheint auch unwahrscheinlich (GW94 S.268f).
Biologisches Bezugssystem konstituiert Bedeutung
Wie Roth feststellt, reicht die Betrachtung einzelner Neuronen oder kleiner Neuronenverbände nicht aus, um über rein physiologische Kennwerte hinaus etwas zu prädizieren, was in irgendeinem Sinne eine Funktion/ Relevanz/ Bedeutung über die Physiologie hinaus besitzt (GW94, S.268f). Dies liegt daran, daß alle Nervenzellen aufgrund ihres physiologischen Baus und ihrer physiologischen Funktionalität hochgradig unspezifisch sind; den einzelnen Nervensignalen kann man z.B. nicht entnehmen, ob sie nun gerade einen sensorischen oder einen motorischen Reiz kodieren, einen akustischen, einen visuellen oder eine Bewegung.
Um die 'Bedeutung' von Nervensignalen erfassen zu können, muß man daher (i) die Architektur des gesamten Gehirns in Rechnung stellen sowie (ii) die Rolle der unterschiedlichen Signalflüsse im Kontext der Interaktionen des Systems mit der gesamten Umwelt fixieren (GW94, S.269).
Dies impliziert mindestens eine biologische Sichtweise, in der das Nervensystem als Teil eines Organismus und der Organismus als Exemplar einer Gattung begriffen wird, die wiederum eine biologische Geschichte hat.
Sprachliche Kommunikation
Die Kommunikation, speziell die sprachliche Kommunikation, stellt für Menschen einen wichtigen Teilbereich der Interaktion mit der Umwelt dar. 'Verstehen' ist ein zentraler Aspekt von sprachlicher Kommunikation und impliziert ausgedehnte konsensuelle Bereiche, die mühsam aufgebaut werden müssen (GW94, S.300). In weiten Bereichen menschlicher Kommunikation sind die Bedeutungszuweisungen nicht in einfacher Weise am Handeln von Personen überprüfbar (GW94, S.301). Das Wissen darüber, ob und inwieweit man sich versteht, muß durch Versuch und Irrtum in selbstreferentieller Weise ausgelotet werden (GW94, S.300).
Eine Konsequenz daraus ist, daß überall dort, wo sprachliche Äußerungen eine Rolle spielen, die 'Objektivitæt' von Bezugnahmen auf 'Wirkliches' mehr oder weniger stark mit 'subjektiven' Faktoren durchsetzt wird. Dies gilt schon für eine so scheinbar unverfängliche Äußerungen wie 'Es regnet draußen.' (GW94, S.318f).
Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion sprachlicher Bedeutung
Insofern alles, was ein Proband A aufgrund seines 'Bewußtseins' empfinden/ erleben/ vorstellen/ denken usw. kann, von A sprachlich zumindest 'artikuliert' werden kann, stellt sich die Frage, ob sich diese Artikulationen 'hinreichend stabil' mit empirischen Tatbeständen korrelieren lassen.
Roth nennt verschiedene Verfahren (z.B. PET, NMR, EEG, S.203), mit denen sich Gehirnaktivitäten messen und damit anzeigen lassen. Diese Verfahren sind speziell auch in der Lage, spezifische Aktivitätsmuster, die komplexen 'Erlebenszusammmenhängen' 'korrespondieren', zu erfassen (GW94, S.253).
Diese Verfahren erlauben aufgrund der meßtechnischen Grenzen jedoch noch kein 'Gedankenlesen'. Die 'semantischen' Vorgeschichten der einzelnen beteiligten Elemente sowie deren Verteilung auf viele kleine Netze, die wiederum vielfältigst miteinander vernetzt sind, macht eine adäquate Messung heute noch unmöglich (GW94, S.254). Dies bedeutet aber, daß die Korrelation von neuronalen Aktivitätsmustern mit Erlebniskomplexen auf seiten der neuronalen Aktivitätsmustern unterbestimmt ist! Die heutigen Meßverfahren bieten zwar einen erfolgversprechenden Ansatzpunkt, um über den Umweg der Korrelation eine empirisch basierte Beschreibungssprache sprachlicher Bedeutungsstrukturen und -prozesse aufzubauen, aber bei dem gegenwärtigen Stand sind die verfügbaren Meßmethoden noch bei weitem zu grob.
Die Korrelationsmethode hat aber noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen. Die empirisch faßbaren sprachlichen Äußerungsdaten, also die Laute, Schriftzeichen oder Gesten, sind nicht die Daten, die eigentlich abgebildet werden sollen. Vielmehr handelt es sich hier nur um die Ausdruckselemente eines Codesystems, das Erlebniskomplexe kodieren soll. Artik-A: PHEN-A x L ---> PHEN-A x EXPR-L. Wie Roth selber feststellt, rühren Verstehensschwierigkeiten gerade daher, daß die vorausgesetzten Abbildungsbeziehungen individuell verschieden sein können und im Normalfall auch verschieden sind (vgl. S.300f). Dies kann zur Folge haben, daß ein Neurobiologe B, der einen Probanden A1 untersucht, möglicherweise den Protokollsatz M(t1,t2,A1,E1,N1) bekommt und im Falle von Proband A2 neben dem 'einfachen' Fall M(t1,t2,A2,E1,N1) den Protokollsatz M(t1,t2,A2,E2,N1) oder M(t1,t2,A2,E1,N2).
Im Falle des Protokollsatzes M(t1,t2,A2,E1,N1) läßt sich bei A2 sowohl das gleiche Erregungsmuster N1 wie bei A1 messen, als auch der gleiche sprachliche Ausdruck E1.
Im Falle des Protokollsatzes M(t1,t2,A2,E2,N1) läßt sich bei A2 zwar das gleiche Erregungsmuster N1 wie bei A1 messen, aber es liegt ein anderer sprachlicher Ausdruck E2 vor. Daraus könnte man entweder schließen, daß A2 anders kodiert wie A1 oder aber, daß das Meßverfahren zu ungenau ist, um die möglicherweise vorhandene Verschiedenheit im neuronalen Muster hinreichend genau erfassen zu können.
Im Falle des Protokollsatzes M(t1,t2,A2,E1,N2) liegt zwar der gleiche sprachliche Ausdruck E1 vor, aber es läßt sich bei A2 ein anderes Erregungsmuster N2 wie bei A1 messen. Auch in diesem Fall könnte man entweder das Meßergebnis anzweifeln oder aber eine unterschiedliche Kodierung annehmen.
Eine Diskussion dieser Fälle fördert zahlreiche Schwierigkeiten zutage:
- Aufgrund der Aussagen von Roth muß man wohl annehmen, daß die heutigen Meßverfahren in den allermeisten Fällen sprachlicher Kodierung zu ungenau sind, um hinreichend differenzierte Daten zu bekommen (aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung kann sich die Ausagekraft dieser Feststellung natürlich in der Zukunft sehr schnell verändern). Der Aufbau einer empirischen Repräsentationssprache für sprachliche Bedeutung erscheint von daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt -aber wielange?- unrealistisch zu sein.
- Und selbst wenn die Meßverfahren erheblich genauer wären, stellt sich die Frage, was eine 'strukturelle Ähnlichkeit' zweier Erregungsmuster N1 und N2 genau besagen würde: kann nicht der 'topologisch gleiche' Zellverband in den Gehirnen von A und B aufgrund der individuell unterschiedlichen Lerngeschichten eine unterschiedliche Funktion im Gesamt des Gehirns haben (man denke z.B, an frühe Schädigungen des Gehirns, die dazu führen, daß andere Gehirnteile die Funktion der ausgefallenen Teile übernehmen)?
- Ferner, ist die Annahme, daß zwei Gehirne strukturell und topologisch bis zur Auflösung von 'kleinen Zellverbänden' 'identisch' sind, überhaupt realistisch?
- Außerdem, worauf gründet eigentlich die Vermutung, daß ein bestimmtes Erregungsmuster Ni einen Erlebniskomplex Pi 'repräsentiert' (ELEMENT(Pi,PHEN)), wenn der Erlebniskomplex Pi aus der Sicht eines Beobachters nirgends direkt auftritt; schon die Verwendung eines sprachlichen Ausdrucks Ei durch einen Probanden basiert ja auf der Unterstellung, daß Ei (ELEMENT(Ei,EXPR-L)) bei dem Probanden unter Voraussetzung einer einigermaßen 'stabilen' Artikulationsfunktion einen Erlebniskomplex Pi kodiert. Die Verwendung von verbalen Äußerungen von Probanden macht von daher eigentlich nur Sinn, wenn man zuvor die Menge der benutzten verbalen Äußerungen als Wertebereich einer Artikulationsfunktion rekonstruiert hat. Nur dann könnte man ansatzweise von einer Korrelation von 'mentalen' mit 'neuronalen' Zuständen sprechen. Andernfalls korreliert man Äußerungselemente, deren Beziehung zu Erlebniskomplexen unklar ist.
- Wie die Geschichte der maschinellen Spracherkennung unmißverständlich zeigt, ist die Rekonstruktion sprachlicher Bedeutung nur aufgrund des Sprachsignals, d.h. nur aufgrund von Ausdrucksmaterial völlig unmöglich. Im wesentlichen liegt dies am konventionellen Charakter der sprachlichen Kodierungsfunktionen: zwischen der 'Form' eines sprachlichen Ausdrucks und seiner 'Bedeutung' gibt es keinen gesetzmäßigen Zusammenhang; die Zuordnung geschieht 'per Konvention', ist ziemlich willkürlich, und kann nur unter Kenntnis der jeweiligen konkreten Verwendungskontexte rekonstruiert werden.
Fazit: die Beschränkung auf sprachliche Ausdruckselemente ist -soweit ersichtlich- unzureichend, will man auf die zu kodierenden Erlebniskomplexe zugreifen.
Einführung des empirischen Begriffs 'Geist' mißlungen?
Wenn Roth, wie zuvor ausgeführt, davon ausgeht, daß man den Begriff 'Geist' als physikalischen Begriff einführen kann, weil man alle jene Zustände, denen wir 'Geist' bzw. 'Bewußtsein' zusprechen, mittels heutiger Meßmethoden mit spezifischen Aktivitätsmustern im Gehirn parallelisieren (korrelieren) kann, stellt sich nun die Frage, welche Zustände er denn meint, von denen er sagt, daß man ihnen 'Geist' bzw. 'Bewußtsein' zuspricht?
Da man seinen Ausführungen entnehmen muß, daß er für seine Korrelationen eben nicht mentale Zustände direkt benutzt, sondern nur das Ausdrucksmaterial einer Sprache, von dem er unterstellt, daß es mental Zustände kodiert, ohne daß er diesen Zusammenhang als solchen explizit aufweist, ist nicht zu sehen, warum Roth davon ausgehen kann, daß er mit diesem Verfahren Begriffe durch Koppelung an neuronale Daten dazu benutzen kann, mentale Zustände zu kodieren. Er kodiert nur Ausdrucksmaterial, das alles oder nichts bedeuten kann.
Wir gehen im Folgenden davon aus, daß der Begriff 'Geist' nur dann auf dem Weg der Koppelung an physiologische Meßwerte eingeführt werden kann, um mentale Zustände zu kodieren, wenn die Artikulationsfunktion des benutzten sprachlichen Materials 'hinreichend' rekonstruiert ist.
Bewußtsein, empirische und philosophische Theorie, Computer
Die bisherigen Überlegungen legen den Schluß nahe, daß sich die tatsächliche Bedeutungszuordnung eines Sprecher/Hörers A nur von demjenigen rekonstruieren läßt, der sie 'benutzt' und der einen 'privilegierten Zugang' zu jenen Erlebniskomplexen besitzt, die jeweils damit kodiert werden sollen. Dies aber kann nur A selbst sein. Das Selbstverhältnis von A verweist auf seine 'Erlebnisperspektive', auf den 'Raum' seines Bewußtseins.
Aus der Sicht der Neurobiologie ist dies keine überraschende These. Wenn man mit Roth annimmt, (i) daß das Bewußtsein eine Konstruktion des reellen Gehirns ist, (ii) daß dieses Gehirn 'sich selbst' nur 'kennt' im Modus seiner 'internen Zustände und Prozesse', und (iii) daß die 'bewußten' Zustände und Prozesse nur eine echte Teilmenge aller Gehirnzustände und -prozesse darstellen, dann kann alles, was ein Gehirn in 'bewußter' Weise von sich selbst weiß, nur in Form eines bewußten Zustandes vorliegen. Etwas anderes ist überhaupt nicht verfügbar.
''Die Wirklichkeit ist die einzige Welt, die uns zur Verfügung steht. Was die Hirnforschung tut, ist das, was Wissenschaft als Teil der Wirklichkeit überhaupt tun kann, nämlich die Phänomene der Hirnforschung und sie so deuten, daß sie in der Wirklichkeit Sinn machen''(GW94, S.297).
Die methodologische Annahme, daß wir erkenntnismäßig mit unserem Erlebnisraum, dem Raum der Phänomene, als primärem, nicht weiter hintergehbarem Datum, beginnen, den wir dann nach und nach strukturieren, benennen, sprachlich durchtränken, ihn partiell mithilfe von Sprachen 'beschreiben' und 'erklären', steht in keinem Widerspruch zu einer möglichen empirischen Theoriebildung.
Um empirische Theorien zu bilden muß ich nicht aus dem Raum der Phänomene heraustreten, im Gegenteil, ich kann mich auf eine charakteristische Teilmenge beschränken. Ferner, um logisch konsistente Aussagengefüge aufzubauen, die Bezug nehmen auf die zu erklärenden Phänomene, muß ich gegenüber der Mathematik oder einer systematischen Philosophie keine speziellen Sprachen oder Logiken erfinden; ich kann die allgemein vorhandenen formalen Sprachen und Logiken benutzen.
Die Beziehung zu einer philosophischen Theorie, so wie der Autor sie versteht, ergibt sich zwanglos: der einzige Unterschied einer philosophischen zu einer empirischen Theorie besteht darin, daß man in einer philosophischen Theorie die Beschränkung auf empirische Phänomene aufheben kann. Die Anforderung an die logische Konsistenz der eigentlichen Theorie bleibt jedoch bestehen. Empirische Theorien sind somit zwangsläufig Teiltheorien von philosophischen Theorien.
Philosophische Theorien sind dort von Interesse, wo es Erklärungsbedarf jenseits der empirisch zugänglichen Fakten gibt. Dies muß nicht zwangsläufig mit Willkür gleichgesetzt werden. Wie die empirische Disziplin der Neurobiologie uns nahelegt, ist die Struktur und die Arbeitsweise des menschlichen Bewußtseins aufgrund seiner biologischen Basis nicht willkürlich; sie gehorcht bestimmten Gesetzen. Eine phänomenbasierte Rekonstruktion des Bewußtseinsraumes, die ihre Aussagen an eine formale Strukturtheorie bindet, kann daher möglicherweise ein hohes Maß an intersubjektiver Gültigkeit gewinnen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Neurobiologie läßt sich die Allgemeingültigkeit dieser Theoriebildung sicher noch zusätzlich steigern.
Im Falle der sprachlichen Bedeutung dürfte die Ausarbeitung einer philosophischen Theorie der Bedeutung nach dem derzeitigen Kenntnisstand z.Zt. sogar die einzige Möglichkeit sein, um überhaupt zu Erklärungsansätzen zu kommen. Daß die Ausarbeitung einer solchen Theorie aufgrund der inhärenten Schwierigkeiten nicht leicht ist kann kein absoluter Grund sein, solch einen Erklärungsversuch erst garnicht zu versuchen.
Durch die Verfügbarkeit von Computern bietet es sich heute an, formale philosophische Theorien durch begleitende Computersimulationen anschaulich, damit 'testbarer', und damit 'kritisierbarer' zu machen. Bei der Ausarbeitung solcher Computersimulationen zeigt es sich, daß man Annahmen treffen muß, wie die zu simulierenden Phänomene zustande kommen. Hier bietet es sich auf natürliche Weise an, die philosophische Analyse durch empirische Modellbildungen bzgl. der generierenden Gehirnstrukturen zu ergänzen.
Was anläßlich solcher Computersimulationen sichbar wird, gilt aber ganz allgemein: jede phänomenbasierte philosophische Analyse läßt sich beliebig weit durch zusätzliche Theoriebildungen erweitern; letztlich gibt es keine festen Grenzen. Empirische, neurobiologische Modelle, die das 'Zustandekommen' jener Phänomene erklären, bei denen die Analyse ursprünglich ihren Ausgangspunkt nahm, sind philosophisch gültig.
Vom Standpunkt einer bewußtseinsbasierten und computergestützeten Philosophie stellt die Neurobiologie damit einen Teiltheorie dar, die von allergrößtem Interessse ist. Könnte die Neurobiologie sich genauso offenherzig als eine philosophische Teiltheorie begreifen? Sie hätte einige methodische Probleme weniger.
Quellen
EuS := Ethik und Sozialwissenschaften 6(1995)1, pp. 69-77, G.ROTH/ H.SCHWEGLER
GW94 := Das Gehirn und seine Wirklichkeit, Suhrkamp, Frankfurt, 1994, G.ROTH
KRSG92 := Kognitive Referenz und Selbstreferentialität des Gehirns, 1992, G.ROTH/ H.SCHWEGLER, in: H.S.SANDKÜHLER (hrsg.), Wirklichkeit und Wissen, Peter Lang, Frankfurt, pp. 105-117.
Comments are welcomed to kip-ml@inm.de
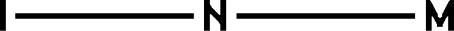
Daimlerstrasse 32, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland. Tel +49- (0)69-941963-0, Tel-Gerd: +49- (0)69-941963-10